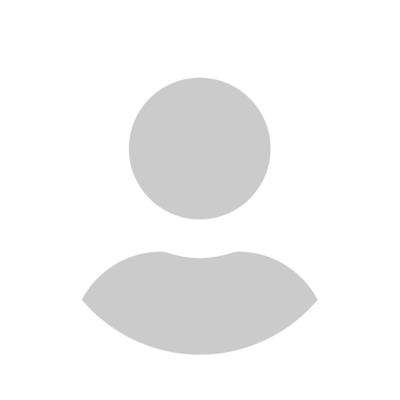Fakultät Elektrotechnik und Informatik
Hier erwerben Sie theoretische Kenntnisse und praktische Fähigkeiten, um softwareintensive Systeme in IT-Projekten umzusetzen.
| Abschluss | Bachelor of Science, ggf. Berufsausbildung |
|---|---|
| Studienbeginn | Wintersemester |
| Bewerbungszeitraum Wintersemester | 01. Juni bis 15. Juli |
| Regelstudienzeit | 7 Semester |
| Credits | 210 |
| Akkreditiert | |
| Zulassungsbeschränkt | Ja |
| Zulassungsvoraussetzungen |
|
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Fakultät/Institution | Fakultät Elektrotechnik und Informatik |
| Auslandsaufenthalt | Optional |
| Studienform | internationales Studium optional, duales Studium optional |
Der Studiengang Informatik: Software- und Systemtechnik (ISS) befähigt Studierende, komplexe technische softwareintensive Systeme zu konzipieren, zu entwickeln, zu testen, zu betreiben, instand zu halten sowie deren Qualität sicherzustellen. Zusätzlich zu der Informatik wird das fachliche Qualifikationsziel des Studiengangs durch zwei etwa gleich starke Schwerpunkte umgesetzt: Hardware (Digitaltechnik, Mikroprozessortechnik, Rechnerarchitektur) und Software (Betriebssysteme, Softwaretechnik, Datenbanken, Rechnernetze).
Der Studiengang Informatik: Software- und Systemtechnik kann sowohl in einer klassischen, in einer dualen wie auch in einer internationalen Variante studiert werden. Während in der klassischen Variante die Lehrinhalte praxisnah an der Hochschule in Form von seminaristischen Unterrichtseinheiten, Übungen und Laboren vermittelt werden, ist die duale Variante um einen Ausbildungsteil innerhalb eines kooperierenden Partnerunternehmens und die internationale Variante um ein einsemestriges Auslandsstudium ergänzt.
Absolvent:innen des Informatik: Software- und Systemtechnik Studiengangs (B. Sc.) werden in ihrem vielgestaltigen Arbeitsumfeld stark nachgefragt. Aufgrund ihrer breiten Ausbildung können sie vielfältige Aufgaben übernehmen, z. B.:
Konzeption, Entwicklung, Qualitätssicherung, Betrieb und Wartung von softwareintensiven Systemen mit Methoden moderner Softwaretechnik.
Entwicklung, Konzeptionierung, Programmierung, Einrichtung und Pflege von Rechnersystemen und Rechnernetzen
Planung, Projektierung, Inbetriebnahme und Betrieb von industriellen Kommunikationsnetzen
Entwicklung und Programmierung von mikroprozessorbasierten Regelungen und Steuerungen
Organisation und Management von softwareintensiven Projekten
Vertrieb und Service im Bereich Hard- und Software
Einsatzgebiete der Absolvent:innen sind Konzeption, Design, Entwicklung, Test, Management, Vertrieb und Service von softwareintensiven Systemen. Die Ausbildung für diese Vielzahl von Einsatzgebieten ist erforderlich, da der Arbeitsmarkt diesbezüglich eine zunehmende Flexibilität vom einzelnen Beschäftigten einfordert. Darüber hinaus bedingt der technische Fortschritt eine breite Qualifikation im Rahmen einer berufsqualifizierenden Hochschulausbildung.
Der Studiengang Informatik: Software- und Systemtechnik in seiner klassischen Variante ist ein grundständiger Studiengang, der sich an junge Frauen und Männer richtet, die ein technisch-orientiertes Interesse an Informatik und deren Anwendung in einem Systemkontext haben und die sich mit ihrer Studiengangswahl breit aufstellen wollen.
Der Studiengang Informatik: Software- und Systemtechnik mit dem Abschluss Bachelor of Science (B. Sc.) bietet den Studierenden einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss in einem interdisziplinären Kontext. Er setzt sich zusammen aus seminaristischen Unterrichtseinheiten in kleinen Gruppen, begleitenden Übungen, Laboren mit hohem Praxisanteil, anwendungsnahen Projekten und einer betrieblichen Praxisphase. Der Studiengang ist gekennzeichnet durch den kontinuierlichen Dialog zwischen Studierenden, Lehrenden und potentiellen Arbeitgebern und bietet die Basis für den direkten Berufseinstieg sowie für einen nachfolgenden Masterstudiengang.
„Ein Studiengang wie „Informatik: Software- und Systemtechnik“ (bis Ende September 2022 noch "Technische Informatik") bietet die spannende Herausforderung der komplexen Inhalte verwoben mit realitätsnahen praktischen Anwendungen, die ich gesucht habe. Diese gemeistert zu haben, macht mich stolz und bietet mir eine sehr gute Grundlage für meinen jetzigen Job.“
Stanislav Voytas Absolvent Technische Informatik, 2022
Duale Studiengänge enthalten Praxisphasen in einem beteiligten Unternehmen. Sie können mit zwei Qualifikationen abschließen: dem international anerkannten Bachelorabschluss und dem Abschluss einer Berufsausbildung.
Im Vergleich zu einer Ausbildung und einem späteren Studium ist die Zeit bei einem dualen Studium insgesamt deutlich kürzer.
Bereits während des Studiums sammeln Sie praktische Erfahrungen im Betrieb. Das qualifiziert Sie gegenüber Mitbewerber:innen mit einem herkömmlichen Studium. Viele Betriebe übernehmen duale Absolvent:innen, da sie praxisorientiert, zielstrebig und leistungsbereit sind. Darüber hinaus sind die dualen Absolvent:innen bereits sozial in das Unternehmen integriert.
Durch die Kombination aus Studium und Praxisphasen in den Unternehmen erhalten Sie während der gesamten Studienzeit eine Vergütung. In vielen Fällen übernimmt der Betrieb zudem die Semesterbeiträge.
Eine Übersicht unserer Partnerunternehmen und der freien Plätze für ein duales Studium finden Sie hier:
Studierende der internationalen Variante verbringen ein Studiensemester an einer ausländischen Hochschule. Durch die Teilnahme an zusätzlichen Veranstaltungen und Unternehmungen im Ausland stärken die Studierenden ihre interkulturelle Kompetenz, um mit anderen Kulturen angemessen und erfolgreich interagieren zu können.
Studierende der internationalen Variante qualifizieren sich durch verbesserte Sprachkenntnisse und durch ihre internationale Kompetenz für den internationalisierten Arbeitsmarkt. Sie können auf Basis ihrer internationalen Studienerfahrung ihre fachlichen Kompetenzen in einem interkulturellen Kontext, auch fremdsprachlich, einsetzen.
In Zeiten der Globalisierung, zusammenrückender Märkte und international agierender Unternehmen mit länderübergreifenden Entwicklungsteams sind sprachliche und interkulturelle Kompetenzen notwendig für ein erfolgreiches Arbeiten. Die internationale Variante des Studiengangs leistet hier ihren Beitrag, um Absolvent:innen mit den erforderlichen Fertigkeiten auszustatten.
Zur Liste der Partnerhochschulen für die Fakultät Elektrotechnik und Informatik
„Das Studium im Internationalen Studiengang Technische Informatik macht mich fit für den globalen Arbeitsmarkt in Informatik und Elektrotechnik.“
Tim Wieborg Absolvent 2020
Die Hochschule Bremen im Allgemeinen wie die Fakultät Elektrotechnik und Informatik im Speziellen haben Partnerhochschulen und Partnerfakultäten in der ganzen Welt. Die zwischen der Fakultät und den ausländischen Partnern vereinbarten Abkommen regeln den Austausch von Studierenden und stellen die Möglichkeit zur Internationalisierung des Studiums dar. Sprechen Sie uns bei Fragen zum Auslandsaufenthalt während des Studiums gerne an.
Prüfen Sie die Bewerbungsfristen und Zulassungsvoraussetzungen für Ihren Wunsch-Studiengang.
Für die duale Variante gilt zusätzlich: Informieren Sie sich über verfügbare Plätze bei einem Partnerunternehmen.
Fragen zum Studiengang beantworten die Ansprechpersonen auf den Studiengangsseiten. Bei weiteren Fragen rund um Ihre Entscheidung für ein Studium an der HSB helfen unsere Beratungs- und Serviceeinrichtungen weiter.
Für die duale Variante gilt: Sie bewerben sich zunächst beim Partnerunternehmen, mit welchem die Hochschule Bremen einen Kooperationsvertrag zur Durchführung des Studiums geschlossen hat. Danach melden Sie sich im Bewerbungsportal der HSB an.
Für die nicht-duale Variante gilt: Sie bewerben sich direkt bei der Hochschule Bremen.
Für die duale Variante gilt: Sie immatrikulieren sich mit dem Praxisvertrag, den Sie mit einem Partnerunternehmen geschlossen haben.
Für die nicht-duale Variante gilt: Sie immatrikulieren sich, nachdem Sie eine Zulassung von der HSB erhalten haben.
Für die duale Variante gilt: Sie starten zum 1. August oder zum 1. September in die Praxis im Unternehmen. Im Herbst beginnt Ihr Studium an der Hochschule Bremen.
Für die nicht-duale Variante gilt: Sie beginnen Ihr Studium im Herbst an der Hochschule Bremen.