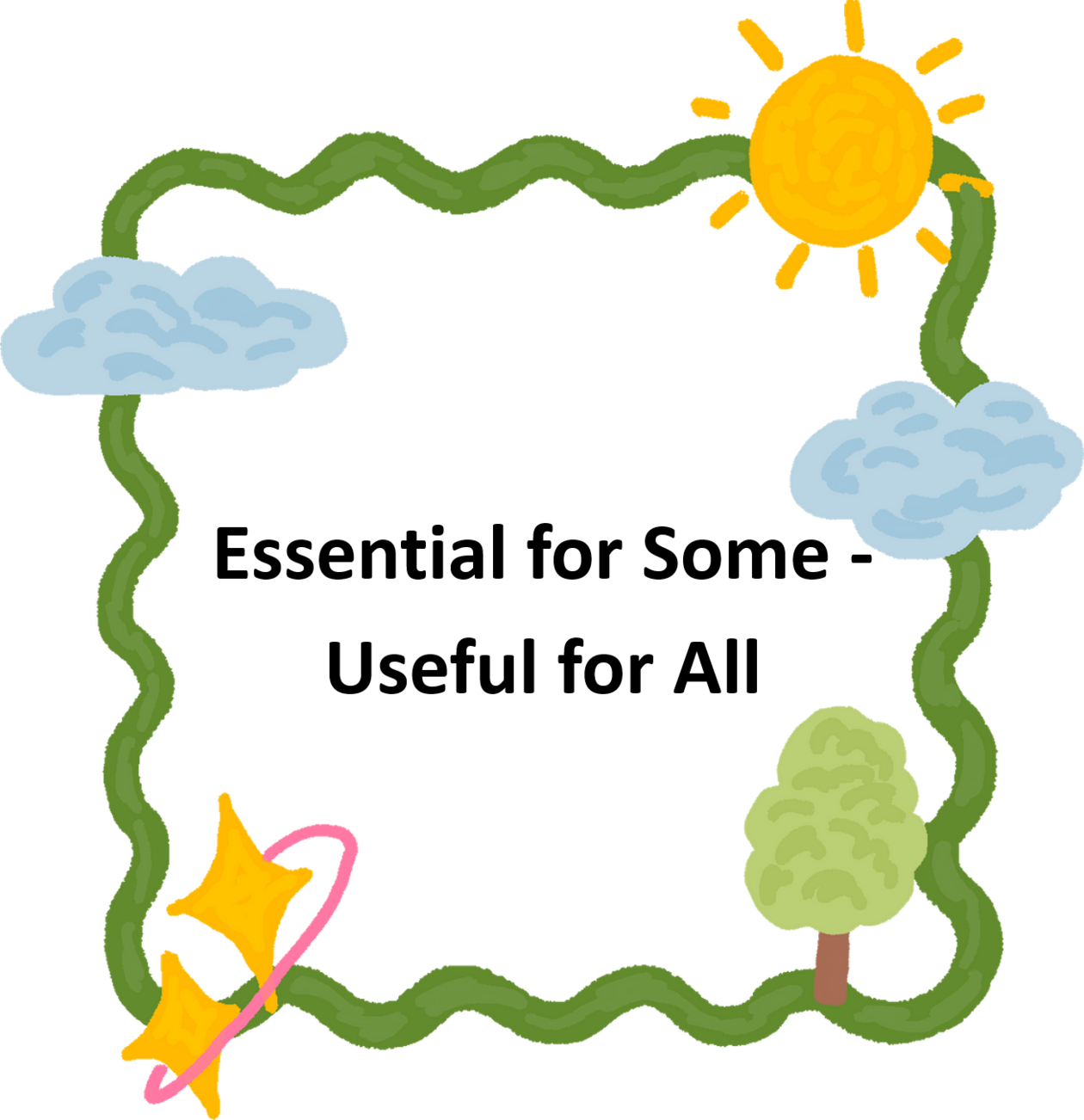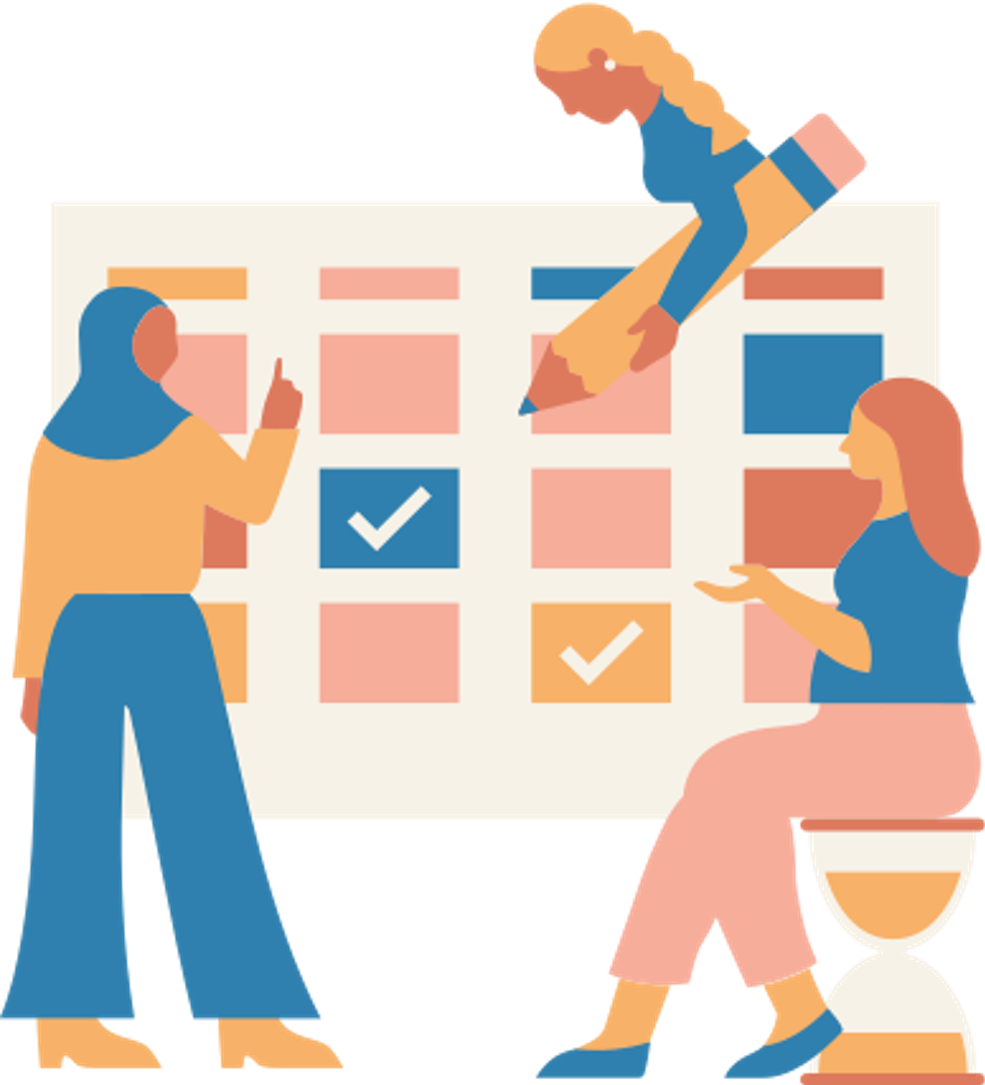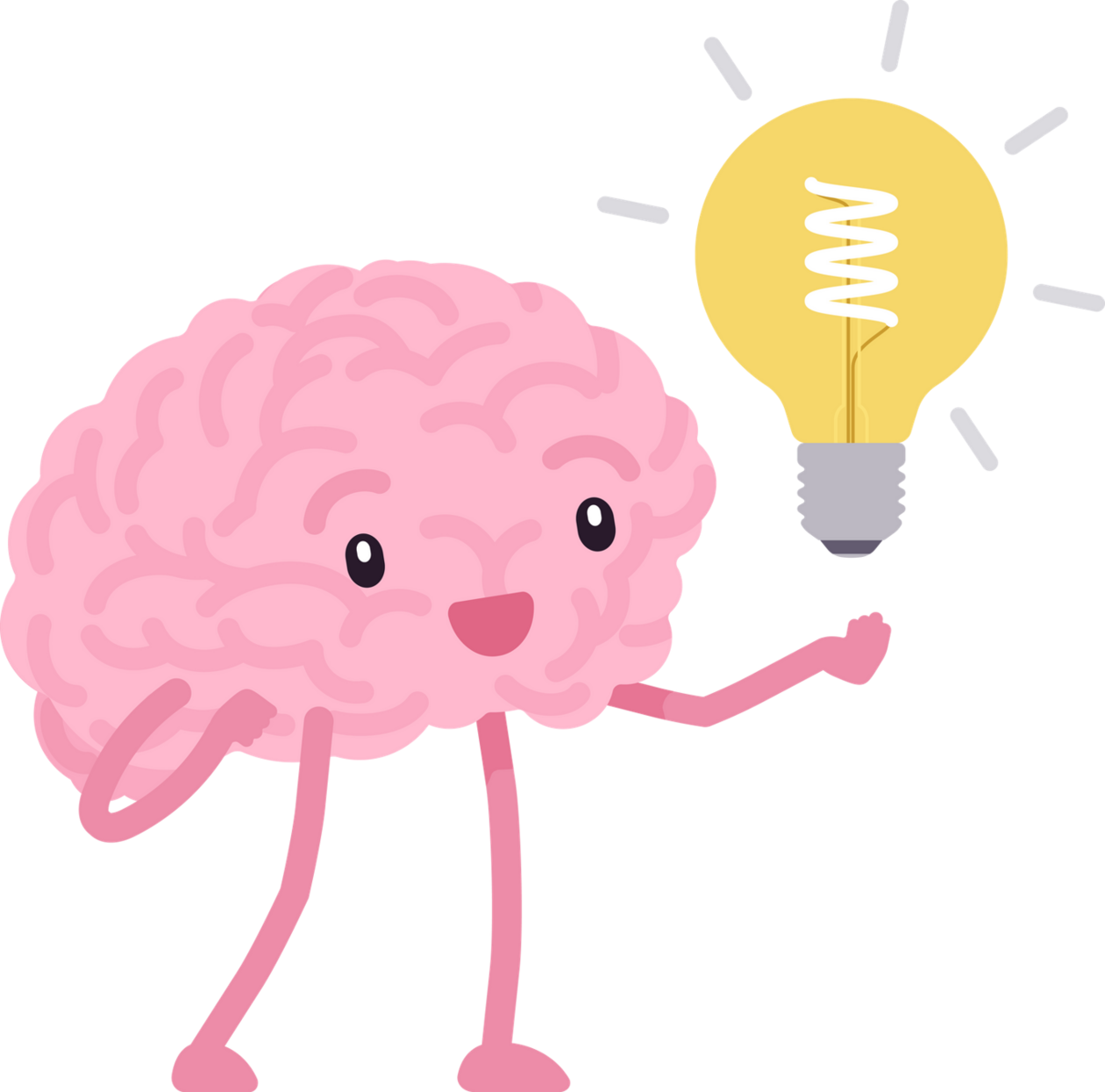Willkommen! Barrierearme Veranstaltungen sind keine Ausnahme, sondern ein wichtiger Bestandteil inklusiver Hochschul- und Veranstaltungskultur. Diese Website bietet Ihnen Hintergrundwissen und praxisnahe Tipps für mehr Zugänglichkeit und Teilhabe. Über das Sprungmarkenmenü kommen Sie auch direkt zu den Praxistipps.
Ob Sie eine Lehrveranstaltung, ein Arbeitstreffen oder eine Fachschaftsparty planen: Barrierefreiheit beginnt bei Ihnen.
Beim Organisieren gilt: "Nothing about us without us" – das Motto der Studierendenvertretung für Behinderte und Beeinträchtigte Studierende (StuBBS). Menschen mit Behinderung müssen aktiv einbezogen und gehört werden, wenn es um ihre Belange geht.
Diese Website basiert auf dem Workshop „All inclusive – barrierearm organisieren", der von StudiumPlus und AddInno gemeinsam mit der StuBBS organisiert wurde.
Barrierefreiheit ist mehr als Rampen und Aufzüge. Sie umfasst alle Bereiche der Teilhabe und orientiert sich am sozialen Modell von Behinderung. Dieses Modell geht davon aus, dass es nicht die individuelle Einschränkung ist, die behindert, sondern die gesellschaftlichen Barrieren.
Dieses Video verdeutlicht durch eine Rollenumkehr sehr gut, wie Barrieren im Alltag aussehen und wie diese Personen ausschließen: The world is designed – EDF commercial (2004).
Die Gestaltung barrierefreier Umgebungen und Veranstaltungen folgt dem Prinzip "Essential for Some – Useful for All" (Essenziell für manche – Nützlich für alle). Dieser Ansatz erkennt an, dass Maßnahmen, die für bestimmte Gruppen unverzichtbar sind, letztlich allen zugutekommen.
Das zeigt sich zum Beispiel bei der Berücksichtigung von Hörbeeinträchtigungen: eine klare visuelle Kommunikation, gute Lichtverhältnisse, eine gute Akustik und wenig Störgeräusche sowie eine strukturierte Gesprächsführung sind bei Schwerhörigkeit oder auch für Verdolmetschung in Deutsche Gebärdensprache zentral. Für alle Beteiligten wird dadurch die Kommunikation verbessert.
Der Slogan "Essential for Some - Useful for All" in einem illustriertem Rahmen.
© Rahmen von Canva - Trendify
"Nothing About Us Without Us" ist dabei mehr als ein Slogan – es sollte ein Grundprinzip Ihrer Planung sein. Suchen Sie aktiv die Zusammenarbeit mit Expert:innen aus der Community und beziehen Sie Menschen mit Behinderungen in den Planungsprozess ein. Seien Sie offen für Feedback und bereit zu lernen, denn jede Veranstaltung bringt neue Herausforderungen und Erkenntnisse mit sich. Nutzen Sie verfügbare Checklisten als Orientierungshilfe, aber seien Sie sich bewusst, dass die konkreten Bedarfe je nach Veranstaltungsformat und Teilnehmendenkreis variieren können.
Nicht alle Menschen können ihre Bedarfe leicht äußern. Besonders privilegierte Menschen sind oft besser darin geschult, Wünsche zu formulieren – planen Sie also Strukturen ein, die leises Feedback ermöglichen.
Wie sichtbar waren Barrieren auf Ihrer letzten Veranstaltung – und wie viele sind Ihnen erst im Nachhinein bewusstgeworden?
Eine erfolgreiche barrierefreie Veranstaltung entsteht durch sorgfältige Planung in allen Phasen des Events. Jede Phase bietet spezifische Möglichkeiten, Zugänglichkeit zu schaffen und Teilhabebarrieren abzubauen.
Illustration von drei weiblich gelesenen Personen, die gemeinsam etwas planen.
© Canva - sparklestroke
Die Vorbereitungsphase legt den Grundstein für eine inklusive Veranstaltung. Eine frühzeitige Planung ist gerade in Bezug auf Barrierefreiheit wichtig, um Informationen rechtzeitig teilen und Bedarfe berückstichtigen zu können.
Eine Veranstaltungswebsite enthält viele Bilder ohne Beschreibung, keine Informationen zu Barrierefreiheit, Anreise oder Lageplänen. Mit Aufwand finden sie auf einer anderen Webseite einen Lageplan ohne Beschreibung.
Geben Sie explizite Informationen zur Barrierefreiheit des Veranstaltungsortes und Anreise an. Verlinken Sie den Lageplan und nutzen Sie beschreibende Texte für Lagepläne und Alternativ-Texte für Bilder.
Die aktive Phase Ihrer Veranstaltung ist entscheidend für eine gelungene inklusive Erfahrung aller Teilnehmenden. Achten Sie besonders auf:
Illustration von drei Personen, die zusammen arbeiten oder lernen.
© Canva - Yuzen Zhang, Sketchify Mexiko
Bei einem Vortrag werden Videos ohne Untertitel gezeigt. Für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen sind die Inhalte nicht zugänglich.
Verwenden Sie Untertitel für alle Videos – idealerweise ergänzt durch Gebärdensprache und Audiodeskription.
Die Phase nach Ihrer Veranstaltung bietet wertvolle Gelegenheiten für Wachstum und kontinuierliche Verbesserung Ihrer inklusiven Praxis:
Illustration eines Gehirns mit Augen, Mund, Armen und Beinen und einer Glühbirne darüber.
© Canva - Andrew Rybalko
Welche Rückmeldungen zur Barrierefreiheit haben Sie erhalten? Wie fließen diese konkret in die nächste Planung ein?
Illustration eines Seminares mit einer Vortragenden und zwei Zuhörenden.
© Canva - Zoé Miserez, sketchify
In einer Lehrveranstaltung wird ausschließlich frontal und ohne Mikrofon gesprochen. Visuelle Materialien sind klein, kontrastarm und schwer lesbar.
Sprechen Sie deutlich, in gemäßigtem Tempo und ins Mikrofon. Stellen Sie vorher Materialien digital zur Verfügung – möglichst in barrierefreiem PDF-Format.
Drei Personen in Festtagskleidung und ein Assistenzhund am Feiern.
© Canva - Samantha Sumulong, Diversifysketch
Auf einer Party werden ohne Vorwarnung Stroboskoplichter verwendet. Menschen mit Epilepsie oder Reizempfindlichkeit fühlen sich unsicher oder schließen eine Teilnahme aus.
Weisen Sie im Vorfeld deutlich auf Licht- und Soundeffekte hin und bieten Sie eine alternative leisere Zone ohne visuelle Reize an.
Illustration einer Person, die mit einem Zeigestock in der Hand referiert.
© Canva - Zabi Jose, sketchify
Ist Ihre Veranstaltung auch für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen verständlich gestaltet?
Verfassen Sie Texte auch in einfacher Sprache, visualisieren Sie Inhalte und bieten Sie begleitendes Material zum Mitlesen an.
Die Organisation barrierefreier Veranstaltungen ist ein fortlaufender Prozess, der Offenheit, Flexibilität und Engagement braucht. Beginnen Sie mit bewährten Checklisten und suchen Sie früh den Austausch mit Menschen mit Behinderungen, um von ihren Perspektiven zu lernen. Barrierefreiheit bedeutet nicht Perfektion ab Tag eins, sondern beständiges Weiterentwickeln. Jeder kleine Schritt hin zu mehr Inklusion zählt.
Denken Sie bei Gesprächen daran:
Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und sie direkt nach bevorzugten Begriffen und Anspracheformen zu fragen.
Nach konkreten Bedarfen für eine Veranstaltung zu fragen – besonders bei der ersten Begegnung.
Keine Fragen nach Diagnosen zu stellen – sie sind für die Organisation einer inklusiven Veranstaltung in der Regel nicht relevant.
Schriftzug: Let's Go!
© Canva