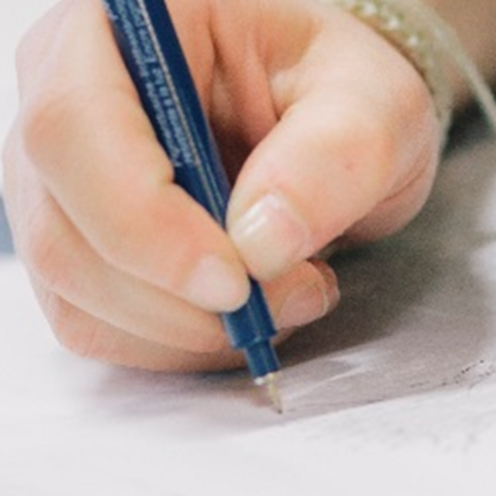Fakultät Wirtschaftswissenschaften
Mit dem Dualen Studiengang Management im Handel B. A. absolvieren Sie ein BWL-Studium mit Fokus auf den nationalen und internationalen Handel. Dabei wenden Sie die Theorie direkt im Unternehmen an. Beste Bedingungen für eine erfolgreiche Karriere als Fach- oder Führungsnachwuchskraft!
| Abschluss | Bachelor of Arts |
|---|---|
| Regelstudienzeit | 7 Semester |
| Credits | 210 |
| Akkreditiert | 2017 über AQAS, ab 2022 innerhalb der Systemakkreditierung. |
| Zulassungsbeschränkt | Ja |
| Zulassungsvoraussetzungen |
|
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Fakultät/Institution | Fakultät Wirtschaftswissenschaften |
| Integrierter Auslandsaufenthalt | Optional |
| Studienformat | duales Studium |
Ausbildung oder Studium? Hier müssen Sie sich nicht entscheiden, denn der Duale Studiengang Management im Handel B. A. (DSMiH) bietet Ihnen beides: ein modernes und breites BWL-Studium mit Spezialisierung auf den Handel, verknüpft mit Praxisphasen im Partnerunternehmen und gegebenenfalls auch den Abschluss einer Berufsausbildung.
So trifft ein anwendungsorientiertes Studium auf intensive praktische Erfahrungen in einem Wunschunternehmen – Sie können aus rund 30 Partnerunternehmen aus dem Einzel-, Groß- oder Außenhandel verschiedenster Branchen von der Mode bis hin zum Holzhandel wählen.
Sie haben bereits eine Berufsausbildung abgeschlossen und möchten sich mit einem Studium weiterqualifizieren? Auch dies ist mit dem DSMiH möglich. Die Theoriephasen absolvieren Sie an der HSB und die Praxisphasen in Ihrem Ausbildungsbetrieb. Sprechen Sie Ihr Unternehmen und uns an!
Im Studium bauen Sie breite betriebswirtschaftliche Kompetenzen auf, erhalten gleichzeitig einen tiefen Einblick in die Welt des Handels und erwerben zudem neben Fach- und Methodenwissen auch Schlüsselkompetenzen:
Ab dem Wintersemester 2025/26 werden keine weiteren Studierenden aufgenommen.
Interesse am Thema?
Der Studiengang "Management im Handel B. A." nimmt weiterhin Studierende auf!
© HSB - Nils Hensel
Durch die frühzeitige und enge Bindung an das Partnerunternehmen sind die Berufsaussichten hervorragend. Die Unternehmen investieren in erheblichem Maß in die Studierenden und sind daher von Beginn an einer längerfristigen Zusammenarbeit interessiert. Auch die Qualität und Ausrichtung des Studiums selbst sichern einen erfolgreichen Berufseinstieg.
Das mögliche Berufsbild umfasst alle betriebswirtschaftlichen Funktionen. Die Anforderungsprofile für Fach- und Führungsnachwuchskräfte unterliegen einem stetigen Wandel.
Mit dem Studienabschluss sind die Studierenden bestens qualifiziert für Managementfunktionen, z.B. im Vertrieb, im (e-)Marketing, im e-Commerce oder in der Distribution, in nationalen und internationalen Handelsunternehmen oder in handelsorientierten Abteilungen anderer Unternehmen.
Für Studienbeginnende ab Wintersemester 2022/23
Naturgemäß ist der Praxisbezug in einem dualen Studiengang sehr hoch.
Im DSMiH wechseln sich Theorie- und Praxisphasen ca. alle drei Monate ab. Im fünften Semester ist zudem eine Intensivpraxisphase integriert, die vollständig im Unternehmen verbracht wird. Viele Studierende verbringen einen Teil der Intensivpraxisphase im Ausland. Während des Schwerpunktstudiums im 6. und 7. Semester ist eine durchgängige und intensive Einbindung in das Unternehmen dadurch gewährleistet, dass Bachelorprojekt und -thesis in der Regel Aufgabenstellungen unmittelbar aus dem Unternehmen behandeln, die mit wissenschaftlichen Methoden gelöst werden.
Durch diese Verzahnung von Theorie und Praxis wird den Studierenden so nicht nur theoretisches Wissen vermittelt. Sie lernen auch, dieses direkt in der Praxis anzuwenden.
In allen Lehrveranstaltungen und Phasen des Studiums hat der Praxisbezug großen Stellenwert. Unsere Lehrkräfte bringen hochqualifizierte Berufserfahrung mit. Projekte und Fallstudien aus der unternehmerischen Praxis stehen auf dem Lehrplan.
Die HSB betreibt den Dualen Studiengang Management im Handel B. A. in Kooperation mit Partnerunternehmen der Region. Die Partnerunternehmen finanzieren die Studienplätze dieses Studienganges.
Der Handel ist heute mehr denn je ein internationales Geschäft. Deshalb bereitet der DSMiH Sie hierauf bestmöglich vor. Im Studium absolvieren Sie in den ersten beiden Semestern zwei Module "Handelssprache Englisch" und vertiefen somit ihre Sprachkompetenz insbesondere in Bezug auf Handelsthemen.
Diese Module dienen der Vorbereitung auf die englischsprachigen Module des 3. und 4. Semesters: „Cross Cultural Communication“ fördert Ihre interkulturelle Kompetenz, während „International Trade and Retail“ sich inhaltlich mit dem internationalen Handel und seinen Rahmenbedingungen befasst.
Der empfohlene mindestens 12-wöchige Auslandsaufenthalt während des fünften Semesters kann je nach Wunsch und Möglichkeiten in einer Auslandsniederlassung des Partnerunternehmens oder in einem frei gewählten Unternehmen im Ausland oder an einer der Partnerhochschulen der HSB stattfinden.
Mit diesen internationalen Erfahrungen gehen Sie dann im sechsten und siebten Semester in das Schwerpunktstudium. Hier ist Internationalität (neben der Digitalisierung, dem demographischen Wandel sowie Ethik / Nachhaltigkeit) ein Querschnittsthema, das in allen Modulen berücksichtigt wird.

Prof. Dr. Martina Harms
Studiengangsleiterin MiH und DSMiH | Professur für Betriebswirtschaftslehre, insb. Personal- und internationales Management
+49 421 5905 4441
E-Mail

Corinne Trümpler
Programm Coordinator
+49 421 5905 4805
+49 176 1514 0186
E-Mail

Henning Voß
Immatrikulations- und Prüfungsamt
+49 421 5905 4112
+49 176 1514 0135
E-Mail