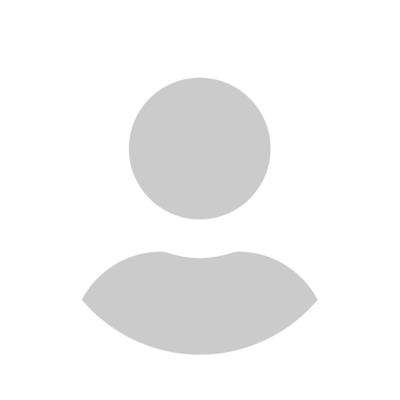Fakultät Elektrotechnik und Informatik
Sie wollen Praxiserfahrung in einem Unternehmen sammeln? Der Studiengang "Technische Informatik" ist eng verzahnt mit diesem Studiengang, allerdings können Sie hier gleichzeitig Praxiserfahrung und Auslandserfahrung passend zum Studiengang sammeln. Steigen Sie jetzt die Karriereleiter hoch!
| Abschluss | Bachelor of Science |
|---|---|
| Regelstudienzeit | 7 Semester |
| Credits | 210 |
| Akkreditiert | Ja |
| Zulassungsbeschränkt | Nein |
| Zulassungsvoraussetzungen | Der Studiengang läuft aus. Es werden keine Studierenden mehr aufgenommen. |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Fakultät/Institution | Fakultät Elektrotechnik und Informatik |
| Auslandsaufenthalt | Ja |
| Studienform | internationales Studium |
Der Internationale Studiengang Technische Informatik ist mit dem nationalen Studiengang Technische Informatik eng verzahnt. Das Konzept des Studiengangs ist die technische Ausrichtung, eine „Informatik mit ingenieurmäßigem Selbstverständnis“. Dieses praxisorientierte Informatik-Studium ist in sieben Semester unterteilt. Das fünfte Semester ist dem Studienaufenthalt an einer Hochschule im europäischen oder außereuropäischen Ausland vorbehalten. Die internationale Ausrichtung des Studiengangs mit dem integrierten Auslandsstudium eröffnet den Absolvent:innen bessere Berufsperspektiven in Zeiten der Globalisierung und zunehmenden Internationalisierung der Unternehmen. Durch Projekte und Wahlpflichtmodule, die das Setzen individueller Schwerpunkte ermöglichen, und Labor-Praktika werden Schlüsselkompetenzen erworben bzw. ausgebaut. Das inhaltliche Wahlpflicht-Angebot ist stets mit den Forschungsaktivitäten der Lehrenden verknüpft. Gruppen- und Projektarbeit fördert die Sozialkompetenz der Studierenden. Modulbezogene Übungen zur Förderung der studentischen Eigenständigkeit dienen der Vermittlung von Lernstrategien und Methoden der Informationsgewinnung. Übrigens: Die Hochschule Bremen hat gleich mehrere passende Bachelor-Angebote: Je nach Interesse, können Sie das Studium auch nur national ausrichten oder dual studieren
Ab dem Wintersemester 2022/23 wird der Studiengang Informatik: Software- und Systemtechnik B. Sc. (klassisch, dual und international) angeboten.
„Das Studium im Internationalen Studiengang Technische Informatik macht mich fit für den globalen Arbeitsmarkt in Informatik und Elektrotechnik.“
Tim Wieborg Student im fünften Semester
Durch den Einsatz von Rechnern in fast allen Gebieten der Wirtschaft können die Produktionskosten in vielen Bereichen auch in Zukunft entschieden gesenkt werden – ein wichtiger Faktor in der Industrie. Dadurch haben Absolventen der Technischen Informatik gute Berufschancen. Ihre Einsatzgebiete umfassen Projektierung, Vertrieb, Service, Fertigung, Produktentwicklung sowie Forschung und Entwicklung.
Die Gelegenheit einen Teil ihres Studiums in einem anderen Land zu absolvieren, ermöglicht es unseren Student:innen neue Einblicke und Erfahrungen zu sammeln, indem sie andere Kulturen besser kennenlernen, neue Bekanntschaften schließen und nicht zuletzt ihre Sprachkenntnisse verbessern.
Für das fünfte oder wahlweise sechste Semester ist ein Aufenthalt an einer ausländischen Hochschule vorgesehen. Es besteht die Möglichkeit eine unserer Partnerhochschulen, beispielsweise in Jordanien, Schweden, den USA, oder eine Hochschule in einem anderen, selbst ausgesuchten Land zu besuchen.
Egal wo es die Student:innen letztendlich hin verschlägt, sie haben dort mindestens 3 Module zu absolvieren, die an der Hochschule Bremen nach Absprache anerkannt werden.